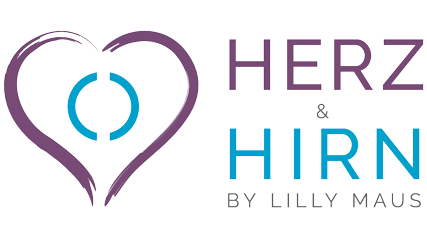Systemisch S wie System oder Subsystem
Systemische Begriffe kurz erklärt

Von Systemisch spricht man, wenn Veränderungen einzelner Elemente Veränderungen anderer Elemente mit sich bringen.
Heiko Kleve
Der Begriff „System“ beschreibt eine Ansammlung aus miteinander verbundenen Elementen, die sich wechselseitig beeinflussen und eigene Strukturen, Regeln und Genzen haben. Systeme entstehen dort, wo Beziehungen zwischen Elementen dichter erscheinen als zu ihrer Umgebung. Oder wie es Kerstin Friedrich, Thomas Bierbaum oder Heiko Kleve in einem Zertifikatskurs „Systemisches Coaching“ in Potsdam formulierten:
System heißt: Elemente gehören aufgrund bestimmter Kriterien zusammen – und andere (Umwelt) gehören nicht dazu.
Friedrich, Bierbaum od. Kleve, 2023 Tweet
Ein System unterscheidet sich von seiner Umwelt durch Strukturen, Regeln und Grenzen, durch die es eine eigene Identität entwickelt – also ein Bild davon, wie es innen sein soll. Diese Unterscheidung ist nicht objektiv gegeben, sondern hängt von der Perspektive der Beobachter:in ab. In der Systemischen Therapie bedeutet das: Wer gehört dazu? Welche Regeln gelten? Wie wird miteinander umgegangen? Was gilt als „normal“ – und was nicht?
Systeme bilden in sich wiederum Subsysteme aus: Ein Paar innerhalb einer Familie. Ein Team in einer Organisation. Ein Geschwisterpaar. Oder auch das Innenleben eines einzelnen Menschen – mit verschiedenen inneren Anteilen, die miteinander in Beziehung stehen. Systeme sind dabei dynamisch: Sie verändern sich, verhandeln ihre Regeln neu und reagieren auf Einflüsse von außen. Gleichzeitig erhalten sie sich selbst, indem sie stabilisierende Muster entwickeln.
Was bedeutet das für die systemische Praxis?
In der systemischen Praxis bedeutet das: Verhalten, Gefühle und Probleme werden nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext von Beziehungen, Rollen und Kommunikationsmustern verstanden. Wer sich zurückzieht, wer laut wird, wer sich kümmert – all das ergibt erst Sinn, wenn wir das System sehen, in dem es passiert.
Systeme begegnen uns überall – in Familien, in Teams, im Freundeskreis oder in Organisationen. In der Systemischen Therapie und Beratung ist es hilfreich, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen: um zu verstehen, wie Probleme sich aufrechterhalten – und wie Veränderung möglich wird, wenn das System sich bewegt.
Therapeut:innen und Berater:innen arbeiten deshalb häufig mit Genogrammen, Aufstellungen oder zirkulären Fragen, um Dynamiken sichtbar zu machen. Ziel ist es, die eigene Position im System besser zu verstehen und neue Handlungsspielräume zu entwickeln – sei es durch Perspektivwechsel, die Stärkung von Ressourcen oder das bewusste Verlassen alter Rollen.
Wenn ich in meiner Praxis mit Klient:innen arbeite, schaue ich nicht nur auf einzelne Symptome oder Verhaltensweisen, sondern immer auch auf die Systeme, in denen diese Sinn ergeben. Manchmal reicht ein Perspektivwechsel, um eingefahrene Muster zu verstehen. Manchmal braucht es neue Impulse, um ein ganzes System in Bewegung zu bringen.
Wenn du neugierig bist, wie dein eigenes System funktioniert – und was darin vielleicht verändert werden möchte – begleite ich dich gern ein Stück auf diesem Weg.
Lassen Sie uns Ihren individuellen Prozess starten.
Nutzen Sie mein Angebot für ein kostenfreies 15-minütiges Erstgespräch.
Beispiel
Disclaimer: Alle Beispiele sind frei erfunden und zum Zwecke der Begriffserläuterung konstruiert. Sie bilden weder die Wirklichkeit noch die Komplexität der menschlichen Psyche ab, da sie einseitig einen Begriff in den Fokus nehmen. Schaubilder wurden entweder eigens für die Fälle erstellt oder inhaltlich maßgeblich verfremdet.
Situation
Herr Möller, Anfang 50, kommt gemeinsam mit seiner Frau in die Praxis. Er beschreibt sich selbst als zunehmend vergesslich. „Ich suche ständig meine Schlüssel, meine Brille, meine Unterlagen. Ich werde langsam verrückt!“ Seine Frau verdreht die Augen: „Immer sucht er was!“
Systemische Perspektive
Statt das „Vergessen“ isoliert als Problem von Herrn Möller zu betrachten, nehme ich eine systemische Haltung ein. Ich richte den Blick auf die Dayde (das Paarsystem) als Subsystem mit eigenen Regeln und Dynamiken. In einem solchen Subsystem geht es nicht nur um zwei Individuen, sondern auch um das „Dazwischen“ – also um Interaktionen, unausgesprochene Vereinbarungen und wechselseitige Muster.
Ich frage das Paar: „Was passiert eigentlich, wenn etwas verloren geht?“ Die beiden lachen. Die Antwort kommt prompt: „Ich werde hektisch, und sie findet es dann meistens.“ Schnell wird klar: Die Situation wiederholt sich nicht zufällig. Immer wenn Herr Möller sucht, reagiert seine Frau. Und das nicht nur mit Hilfe, sondern auch mit leichtem Vorwurf, manchmal mit einem liebevollen Augenrollen. Herr Möller lächelt: „Na ja, manchmal bekomme ich dann sogar einen Kaffee, damit ich mich beruhige.“
Systemische Interventionen
Hypothese und Reflexion
Wir entwickeln gemeinsam eine Hypothese: Das „Vergessen“ könnte eine unwillkürliche Coping-Strategie sein, um Zuwendung zu bekommen. Vielleicht nicht bewusst gesteuert, aber wirksam. Herr Möller beginnt, über Situationen nachzudenken, in denen er sich unter Druck fühlt. „Wenn viel los ist im Büro, dann passiert das am häufigsten. Ich komm nach Hause, bin durch – und dann finde ich nix mehr.“ Seine Frau ergänzt: „Und dann bist du auch endlich mal langsamer.“
Neue Perspektiven öffnen
Wir besprechen, wie sich beide fühlen, wenn diese Dynamik entsteht. Es geht nicht um Schuld oder Absicht, sondern um Wirkung. Herr Möller ist erleichtert: „Ich hab mich schon gefragt, ob ich frühzeitig dement werde.“ Die neue Sichtweise entlastet ihn. Gleichzeitig entwickelt das Paar Ideen, wie sie sich gegenseitig anders begegnen können, ohne dass es das „Vergessen“ braucht: bewusste Pausen, mehr direkte Kommunikation über Bedürfnisse, kleine Rituale für den Übergang vom Arbeits- ins Familienleben.
Was nehmen die beiden mit?
Das „Problem“ war ein Signal. Durch die systemische Betrachtung wurde deutlich: Herr Möllers Verhalten macht innerhalb des Systems Sinn. Das heißt nicht, dass er nicht mehr achtsam mit seinen Dingen umgehen muss – aber es bedeutet, dass beide einen anderen Blick darauf entwickeln konnten, was zwischen ihnen passiert. Neue Handlungsspielräume entstehen, wenn Symptome nicht nur beseitigt, sondern verstanden werden.
Sie müssen nicht gleich Ihre Schlüssel verlieren, um das Zusammenspiel in Ihren Beziehungen besser zu verstehen. Aber manchmal lohnt sich ein Blick auf das, was hinter einem Verhalten steckt – vor allem, wenn es sich wiederholt. Wenn Sie neugierig geworden sind, wie Ihre Beziehungen und Muster aus systemischer Perspektive betrachtet werden können, begleite ich Sie gerne dabei. In einem geschützten Rahmen, mit Humor, Klarheit und dem Blick für das, was zwischen den Zeilen liegt.