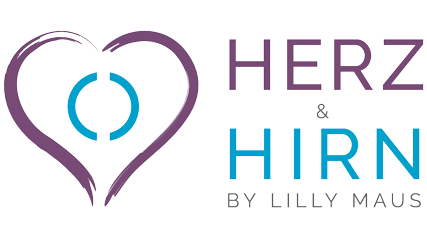Systemisch M wie Mehrgenerationale Traumata
Systemische Begriffe kurz erklärt

Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. / The past is never dead. It's not even past.
William Faulkner
Die mehrgenerationale Perspektive im systemischen Ansatz betont die Bedeutung von Loyalitätsbindungen innerhalb von Familien, die als unsichtbare, aber starke Fasern das Beziehungsverhalten über Generationen hinweg zusammenhalten. Dieses Konzept erweitert den Blick über das aktuelle Geschehen hinaus und untersucht, wie Verhalten, Erleben oder Symptome Sinn ergeben, wenn man Vermächtnisse aus früheren Generationen berücksichtigt und fragt, inwieweit diese erfüllt wurden oder erfüllbar waren.
Darüber hinaus legen unterschiedliche Forschungsergebnisse nahe, dass Traumatisierungen der Eltern nicht nur Spuren auf neurobiologischer Ebene (veränderte Stresshormonspiegel), sondern auch epigenetische Veränderungen bei Kindern hervorrufen können.
Dies wird u.a. in einem Artikel zu den Folgen früher Traumatisierung aus neurobiologischer Sicht von Brückl, T.M., Binder, E.B. im Forens Psychiatr Psychol Kriminol 11, 118–132 (2017) beschrieben:
Mittlerweile liegen nicht nur aus dem Tiermodell Hinweise vor, dass bereits vorgeburtliche Traumatisierungen der Eltern beim Nachwuchs epigenetische Modifikationen hinterlassen können, ohne dass der Nachwuchs selbst traumatisiert wurde.
Brückl, T.M., Binder, E.B., 2017
Mit anderen Worten: Probleme, Konflikte, Leid oder auch Symptome wie Ängste, Depression oder Traumafolgestörungen, erscheinen nicht isoliert, sondern stehen oft in Verbindung mit transgenerationalen Weitergaben — mit Loyalitäten, Aufträgen, Schweigen, Schuld sowie Scham- und Schuldgefühlen, Delegationen, Vermeidungsverhalten und unerfüllten Erwartungen sowie physiologischen und genetischen Veränderungen in Bezug auf den Stresshormonspiegel, die sich durch die Familiengenerationen ziehen.
Die gute Nachricht ist, auch ererbte Wunden (sog. mehrgenerationale oder transgenerationale Traumata), können mithilfe von systemischer Traumatherapie verarbeitet werden.
Lassen Sie uns Ihren individuellen Prozess starten.
Nutzen Sie mein Angebot für ein kostenfreies 15-minütiges Erstgespräch.
Mehrgenerationale Perspektive in der Systemischen Praxis
In der systemischen Praxis können mehrgenerationale Muster, Verstrickungen und Loyalitäten u.a. durch folgende Interventionen sichtbar gemacht und traumasensibel bearbeitet werden:
Genogramm / Familiengenogramm: Mehrgenerationale Visualisierung von Beziehungen, wichtigen Lebensereignissen, Auslassungen, Geheimnissen, Todeszeiten, Migration, Schweigen etc.
Familienaufstellung: In imaginativer oder narrativer Weise Szenen vergangener Generationen rekonstruieren, um Zugang zu deren innerem Erleben zu ermöglichen.
Hypothesenbildung zu Loyalitätsmustern / Delegationen: Auf Basis der Genogramm- und Narrativarbeit Hypothesen aufstellen, welcher Vorfahrin / welchem Vorfahren möglicherweise etwas zugemutet oder übertragen wurde, und welche stillen Erwartungen bestehen könnten.
Schuld- und Verdienstkonten / Geben und Nehmen: Analysieren, inwieweit Vorfahren etwas „gegeben“ haben, etwas „genommen“ haben, wo Ungleichgewichte bestehen und welche Erwartungen das heute erzeugt.
Neuverhandlung von Bindungen (bezogene Individuation): Unterstützung dabei, eine gesunde Balance zwischen der Autonomie (Ich-Werden, Eigene Ziele setzen) und der Beziehungsfähigkeit (Verbundenheit mit anderen) zu finden, ohne eine zu starke Trennung oder eine zu starke Einengung zu erleben.
Symbolische / ritualisierte Interventionen: z. B. Briefe an Vorfahr:innen, symbolische Abschiedsrituale, wertschätzende Anerkennung von Geschichte.
Beispiel
Disclaimer: Alle Beispiele sind frei erfunden und zum Zwecke der Begriffserläuterung konstruiert. Sie bilden weder die Wirklichkeit noch die Komplexität der menschlichen Psyche ab, da sie einseitig einen Begriff in den Fokus nehmen. Schaubilder wurden entweder eigens für die Fälle erstellt oder inhaltlich maßgeblich verfremdet.
Situation
Erika sucht meine Praxis auf, weil sie seit Jahren unter einer diffusen Angst und permanenten Anspannung leidet, die sie selbst als irrational empfindet. Hinzu kommen Schlafstörungen und eine tiefsitzende Überzeugung, dass sie „kein Recht auf echtes Glück hat„. Sie ist beruflich überdurchschnittlich erfolgreich, doch jeder Erfolg wird von einem sofortigen Schuldgefühl und der Angst vor einem folgenden Unglück überschattet. Und sie ist einsam, findet keinen Partner und fühlt sich mehr und mehr ausgebrannt. Sie spürt, dass sie „zu viel Arbeitet“ und „kein Leben hat„. Ab und zu geht sie mit Kolleg:innen nach der Arbeit noch einen Trinken, kann aber auch das nicht so richtig genießen. Sonst pflegt sie kaum soziale Kontakte. Echte Freundschaften, geschweige denn eine Beziehung, hat sie nicht.
Systemisch-Traumatherapeutische Interventionen
Die Arbeit mit mehrgenerationalem Trauma erfordert ein äußerst feinfühliges, Vorgehen, das die traumatische Belastung der Klientin (Sekundär-Traumatisierung) ernst nimmt und gleichzeitig die systemischen Verstrickungen löst.
1. Stabilisierung (Ressourcen und Sicherheit)
Im ersten Schritt geht es darum die Klientin im Hier und Jetzt zu verankern und ein gewisses Maß an Kontrolle über die ererbten Gefühle für sie erfahrbar zu machen. Hier können u.a. folgene Interventionen zum Einsatz kommen:
Ressourcenarbeit: innere/äußere Helfer, sichere Orte und Schutzräume bauen, Selbstfürsorgende Mikro-Rituale für Alltag etablieren, Bewältigungserfahrungen fördern
Atem-/Körper-Anker & Grounding: Orientierung, Selbstregulation, Distanzierungstechniken, Gegenwartsbezug fördern
Psychoedukation: Hypothesenbildung zu Loyalitäten/Delegationen (wer „trägt“ was für wen? welche Aufträge gibt es?), Trauma-Reaktion auf das Nervensystem erklären (Polyvagal-Theorie, Stress-Toleranz-Fenster, ggf. auch Entlastung durch eine Diagnose ect.)
Therapeutischer Rahmen als „sicheren Ort“ etablieren: Verlässlichkeit, Transparenz, Selbstverantwortung, klare Grenzen, Aufbau einer stabilen therapeutischen Beziehung
2. Mehrgenerationale Verstrickung sichtbar machen
In dieser Phase geht es darum, die Kette der Weitergabe zu erkennen. Hierbei können sowohl psychisch-emotionale wie z.B. das Erziehungs- und Bindungsverhalten der wichtigsten Bezugspersonen als auch physiologisch-genetische Faktoren wie z.B. der Kortisolspiegel der Mutter während der Schwangerschaft oder die allgemeine Stressresilienz der Eltern eine Rolle spielen.
Emotional abwesende, überängstliche, unsicher gebundene oder leicht reizbare Eltern tendieren eher dazu die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht oder falsch zu verstehen oder gar in Überforderungssituationen physische oder emotionale Gewalt anzuwenden. Aber auch Schweigen über bestimmte „heikle“ Themen oder das Vermeiden von Situationen, die in den Augen der traumatisierten Vorfahren „zu gefährlich“ sind, prägen das Sicherheitsgefühl der Schutzbefohlenen. Wenn Eltern aufgrund eigener traumatischer Erfahrungen zu der inneren Überzeugung gekommen sind, dass die Welt kein sicherer Ort ist, haben Kinder laut Rahel Bachem (2019) die Schwierigkeit altersgerechte Erfahrungen zu machen, da Ihre Autonomie eingeschränkt wird:
Neue Situationen, Abweichung von Routinen, oder Kontakt mit unbekannten Personen können als bedrohlich eingestuft werden und mit einem erhöhtem Bedürfnis, das eigene Kind zu schützen einhergehen. Die Folge ist, dass Eltern zu überbehütendem Verhalten neigen.
Bachem R., Intergenerationale Weitergabe von Traumata, PiD - Psychotherapie im Dialog 2019; 20: 42–45
In der Arbeit mit Erika könnten zum Beispiel folgende Interventionen hilfreich sein:
- Genogramm-Arbeit: Erstellung eines detaillierten Genogramms, das nicht nur Fakten, sondern auch Familiendynamiken und Tabuthemen sichtbar macht. Es wird nach Impliziten Erzählungen gesucht: Welche Themen wurden in der Familie von Erika vermieden? Welche Vorurteile wurden gepflegt und wer war grundsätzlich Schuld an allem? Welche Verhaltensweisen wurden hingegen belohnt? Durch welche typischen Situationen geriet das Familiensystem regelmäßig ins Ungleichgewicht?
- Familienaufstellung: In einem sicherem Rahmen (mit einem hohen Maß an Kontrolle, Tempo und Selbstbestimmung durch Erika) können wir ihre Vorfahren in den Raum holen. Je nach Möglichkeiten kann dies mithilfe von Stellvertreter:innen, symbolischen Objekten (Bodenanker, Spielzeug oder Materialien aus der Natur) oder Figuren auf einem Familienbrett erfolgen. Mithilfe von Aufstellungen kann das erlebte teils emotional-körperlich nachvollzogen und kontextualisiert werden. D.h. das Trauma kann in den systemischen Zusammenhang eingebettet werden, wodurch Schuld- und Schamgefühle reduziert und transgenerationale Delegationen erkannt werden („Ich trage die Angst meiner Mutter“). Durch die Entwicklung einer Lösungsskulptur können dann im nächsten Schritt, alternative Handlungsmöglichkeiten in einem sicheren Rahmen erprobt werden.
- Zirkuläre, narrative und andere systemische Fragen können bei der Selbstdifferenzierung unterstützen und eine Unterscheidung zwischen dem Trauma der Vorfahren und den eigenen Erfahrungen ermöglichen: „Wenn Sie Ihre Großmutter wären, was würden Sie sich dann von Ihrer Enkelin wünschen? Und was wünschen Sie, Erika, sich selbst, in diesem Moment von Ihrer Großmutter?“. Nur was wir kennen, können wir erkennen. Und nur was wir erkennen, können wir neu in unsere eigene integrieren.
- Ahnenforschung und Kommunikation: Erika wird ermutigt, sich aktiv mit Ihrer Geschichte auseinanderzusetzen (Bücher, Akten, Gespräche mit Verwandten). Kommunikation über das Trauma kann dabei unterstützen, die weitergegebenen Verhaltensweisen einzuordnen und besser mit ihnen klarzukommen.
Mehrgenerationale Traumata in Erikas Familie
Die Großeltern
Erika lernt durch diese Biographiearbeit, dass ihre Großeltern mütterlicherseits als Kinder Vertreibung und den Verlust von Geschwistern im Zweiten Weltkrieg erlebten. Über dieses Ur-Trauma wurde in der Familie geschwiegen. Das unbewusste, in der Familie etablierte Überlebensmotto lautete: „Blos nicht auffallen, dann sind wir sicher.“ und „Erwarte nicht zu viel vom Leben, dann kannst Du auch nicht enttäuscht werden.“
Die Eltern
Ihre Mutter entwickelt in Folge der Kriegserlebnisse ihrer Eltern im Laufe Ihres Lebens eine Soziale Phobie und leidet unter Migräne.
Ihr Vater, verlor seine Mutter bei der Geburt des jüngeren Bruders, musste sehr früh Verantwortung übernehmen und war als Kind sehr einsam, da sein Vater viel arbeitete. Er versuchte für den kleinen Bruder da zu sein, fühlte sich jedoch von dessen Bedürfnissen überfordert. Im Jugendalter verschaffte er sich durch den Konsum von Alkohol Auszeiten von seinen belastenden Gefühlen und fand bei seinen Saufkumpanen erstmals zwischenmenschliche Verbindungen. Da er nicht mehr zuverlässig für seinen kleinen Bruder da war, kam dieser in ein Kinderheim. Einerseits war er darüber froh andererseits schämte er sich und hatte das Gefühl versagt zu haben. Um diesen Gefühlen zu entkommen, flüchtete er sich in die Kneipe und entwickelte über die Jahre eine Alkoholerkrankung.
Die Eltern lernten sich in einer psychiatrischen Klinik kennen. Zunächst fühlten sie sich durch ihre Vergangenheit und das erfahrene Leid miteinander verbunden. Später jedoch verstärkten sich die erlernten Copingstrategien gegenseitig und führten zu einer Reinszenierung der Traumata: Die Alkoholexzesse des Vaters waren der Mutter extrem unangenehm, wollte sie doch um keinen Preis negativ auffallen. Aber sie gab sich selbst die Schuld: „hätte sie nicht so viel von dieser anfangs großen Liebe erwartet und sich nicht angemaßt dieses Glück in Anspruch zu nehmen, wäre das alles nicht passiert„. Der Vater fühlt sich schnell durch die Bedürftigkeit seiner Frau überfordert und flieht wieder in den Alkohol und zu seinen Freunden in der Bar. Von Scham- und Schuldgefühlen geplagt schleicht er sich spät nachts ins Haus und schläft in der Kammer im Untergeschoss.
Erikas Kinderseele
Erika weiß, dass es den Eltern geht nicht gut geht. Sie versucht nicht aufzufallen, ist ein braves fleißiges Kind, lernt für sich selbst zu sorgen und den Eltern keinen Kummer zu machen. Und ganz wichtig, sie stellt keine Fragen. Warum der Papa in der Kammer schläft, ist ein absolutes Tabu-Thema. Die Mama fängt bei solchen Fragen sofort an zu weinen der Papa versinkt in Schweigen und verlässt kurz darauf das Haus, woraufhin Erika von der Mama einen leidend-vorwurfsvollen Blick bekommt, bevor diese wortlos in ihr Zimmer verschwindet.
Wenn Erika mit guten Noten nach Hause kommt, ist ihr Vater stolz auf sie und bleibt am Abend zuhause, um mit ihr zu feiern. Die Mutter meidet dieses gesellige Beisammensein von Tochter und Vater und will nichts von dem Erfolg ihrer Tochter wissen. Sie zieht sich angewidert mit den Worten „Hochmut kommt vor dem Fall“ zurück. Wenn Erika als Jugendliche das Haus verließ, ermahnte die Mutter sie stets keine auffällige Kleidung zu tragen und im Kontakt mit anderen vorsichtig zu sein -man kann nie wissen, wem zu trauen ist und wem nicht.
3. Integration mehrgenerationaler Traumata (Ablösung und Neuausrichtung)
Ziel dieser Phase ist nicht, das Leid zu ungeschehen zu machen, sondern es als Teil der Familiengeschichte zu integrieren und gleichzeitig ungesunde, nicht mehr hilfreiche Loyalitätsbindungen zu lösen, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Hierbei kommen u.a. folgende systemische und traumatherapeutische Interventionen zum Einsatz:
- Die Rückgabe-Übung (Return Exercise): Erika schnürt symbolisch ein Paket mit allen übernommenen Lasten (die nicht ihr gehören: die Angst der Mutter, die Überforderung und Schuldgefühle des Vaters) und gibt es in einer Imagination an die entsprechende Bezugsperson zurück. Dies geschieht in einer Haltung der Anerkennung und Entlastung: „Ich sehe dein Leid, aber ich trage es nicht mehr für dich“.
- Traumasensitive Anteile-Arbeit: Mittels traumatherapeutischer Methoden (z. B. EMDR, Innere-Kinder-Retten) wird der traumatisierte innere Kindanteil oder die verinnerlichte leidende Bezugsperson (Introjekt) bearbeitet. Erika verarbeitet das Trauma nicht für ihre Vorfahren, sondern für sich selbst und ihre eigene psychische Struktur.
- Bezogene Individuation: Erika lernt Gefühle und Verhaltensweisen, die Sie sich aus Loyalität und zum Erhalt der Bindung zu Ihren Eltern angeeignet hat und ihre eigenen Bedürfnissen und Gefühlen zu unterscheiden. Sie lernt sich von den den Ängsten ihrer Mutter zu distanzieren und kann es sich mehr und mehr erlauben ihre Erfolge zu feiern und ihr zu Glück genießen. Sie lernt, dass die Schuldgefühle des Vaters ihm gehören. Sie muss sich nicht für seine Alkoholsucht schämen und sie muss ihn auch nicht retten indem sie ihn stolz macht.
Was nimmt Erika mit?
Im Laufe der Therapie versteht Erika, dass ihre Ängste und Schuldgefühle nicht ein Fehler ihrer Persönlichkeit sind und kann sie als äußerst kompetente Bewältigungsmechanismen ihres jüngeren Selbst auf die Umstände in ihrem Herkunftssystems anerkennen und würdigen. Eine Reaktion auf eine Geschichte, die lange vor ihr begann.
Sie erkennt, dass Schuld- und Schamgefühle, die Übervorsicht und Angst vor Erfolg sowie das ständige Funktionieren einmal Schutzstrategien waren: für ihre Eltern, für deren Eltern und vielleicht Generationen davor. Doch sie fühlt auch, dass diese Strategien heute für sie nicht mehr hilfreich und auch nicht mehr notwendig sind.
Indem sie die Geschichten ihrer Familie nicht länger für, sondern über sich erzählt, kann sie Verantwortung dorthin zurückgeben, wo sie hingehört. Sie spürt, dass Zugehörigkeit nicht bedeutet, Lasten zu tragen, sondern die Verbindung zu würdigen, aus der sie entstanden ist.
So entsteht ein neues inneres Gleichgewicht: aus Loyalität wird Freiheit, aus Schuld Mitgefühl, aus Angst Vertrauen.
Vielleicht spüren auch Sie, dass Themen in Ihrem Leben ihre Wirkung entfalten, die sich nicht allein aus ihren eigenen Erfahrungen erklären lassen. Dass Gefühle, Glaubenssätze oder Verhaltensmuster stärker scheinen, als es Ihr eigener Lebensweg vermuten lässt.
In der systemischen Traumatherapie können wir gemeinsam hinschauen, was Generationen vor Ihnen geprägt hat – und was Sie davon weitertragen oder loslassen möchten.
Herzlich Ihre
Lilly Maus