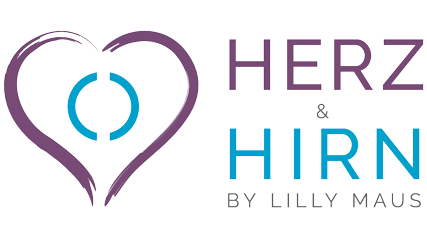Systemisch X wie Xenophobie
Systemische Begriffe kurz erklärt

Ignoranz und Vorurteile sind die Mauern des Friedens.
Kofi A. Annan
Xenophobie ist kein originär-systemischer Begriff aber ein für die systhemische Arbeit gleichermaßen brisantes wie relevantes Phänomen.
Aus diesem Grund habe ich mich entschieden hierzu einen Blogartikel zu schreiben, der Xenophobie als strukturelles (systemisches) Phänomen einordnet und die sich daraus ergebenden Grenzen des systemischen Prinzips der Allparteilichkeit beleuchtet.
Begriffsdefinition
Xenophobie bezeichnet die Furcht gegenüber “dem Fremden” (griechisch ξενοφοβία) und die damit einhergehende Ablehnung von Menschen, die als andersartig wahrgenommen werden, sei es aufgrund von Kultur, Herkunft, Sprache oder Religion. Xenophobie führt häufig zur Bildung von Vorurteilen und kann sich in diskriminierendem Verhalten zeigen.
Systemische Einordnung
Eine pathologische Xenophobie gilt in der klinischen Psychologie als eine Form der Angststörung.
In der systemischen Arbeit mit xenophobischen Menschen stoßen wir zum Einen an die Grenzen des Prinzips der Allparteilichkeit, da Xenophobie häufig zu diskriminierendem Verhalten führt (siehe Xenophobie und die Grenzen der Allparteilichkeit).
Zum Anderen treffen wir auf ein klassisch-systemisches Phänomen: denn Xenophobie ist nicht nur ein individuelles, sondern vielmehr ein strukturelles Problem, da sie durch gesellschaftliche Machtverhältnisse und heteronormative Narrative verstärkt wird. Systemiker:innen sind somit gefordert, diese Dynamiken mitzudenken. Es reicht nicht, „alle gleich“ zu behandeln, wenn strukturelle Ungleichheiten existieren.
Xenophobie und die Grenzen der Allparteilichkeit
In der systemischen Theorie gibt es das Prinzip der Allparteilichkeit, das darauf abzielt, in der Arbeit mit Klient:innen neutral zu bleiben und alle Perspektiven gleichermaßen zu würdigen.
Doch Xenophobie stellt uns hier vor eine Herausforderung: wenn sie sich in diskriminierendem Verhalten manifestiert, können wir als systemische Fachkraft nicht einfach neutral bleiben. Die Neutralität der Berater:in oder Therapeut:in in Bezug auf unterschiedliche Perspektiven funktioniert hier nicht in der gewohnten Weise, da wir im Zusammenhang mit diskriminierendem Verhalten Verantwortung übernehmen müssen.
Wenn du neutral bist in Situationen der Ungerechtigkeit, hast du die Seite des Unterdrückers gewählt.
Desmond Tutu
Verantwortung übernehmen heißt in diesem Zusammenhang die strukturellen systemischen Aspekte des Phänomens zu erkennen (siehe nächster Absatz), zu benennen und sich mit einer klaren Haltung zu positionieren. Hierfür ist es hilfreich, den Unterschied zwischen dem individuellen Aspekt der Xenophobie, also der Angst eines Menschen und der strukturell begünstigten Projektion dieser Angst auf andere Personen, klar zu haben. Wir können den Ängsten einer Person würdigend und verständnisvoll begegnen und müssen gleichzeitigt diskriminierende Äußerungen und Verhaltensweisen als inakzeptablen Coping-Mechanismus aufdecken und benennen.
Xenophobie als strukturelles Phänomen
Die strukturelle Perspektive betrachtet Beziehungsstrukturen und Subsysteme in Familien, Organisationen oder gesellschaftlichen Systemen. Sie betrachtet Faktoren wie Zusammengehörigkeit, Macht, Nähe, Loyalität und Ausschluss sowie die Bildung von Subsystemen. Entscheidend sind Grenzziehungen, die laut Salvador Minuchin dysfunktional sein können.
Wenn wir uns mit Xenophobie als Angstphänomen auseinandersetzen bzw. im therapeutischen Kontext auf Xenophobie stoßen, ist es wichtig die strukturellen Aspekte des Phänomens zu verstehen. Individuelle Ängste werden durch gesellschaftliche Machtverhältnisse gestützt, durch vorherrschende Narrative über das „Fremde“ genährt und durch heteronormative Standpunkte bagatellisiert und toleriert. In der systemischen Arbeit ist es unerlässlich, diese strukturellen Einflüsse zu berücksichtigen und zu verstehen, dass es nicht reicht, „alle gleich“ zu behandeln, wenn strukturelle und narrative Ungerechtigkeiten existieren, die bestimmte Menschen oder Gruppen system(at)isch benachteiligen und ausgrenzen.
Neben couragiertem, aktivem antidiskriminierendem Verhalten geht es also auch um diskriminierungssensible therapeutische Angebote, die diskriminierungserfahren(d)en Menschen einen sicheren, inklusiven Raum bieten.
Ich bin mir als weiße, heteronormativ sozialisierte Frau meiner Grenzen dies leisten zu können bewusst und halte es gleichermaßen für meine Pflicht, meinen Beitrag zu leisten, indem ich mich mit dem Thema auseinandersetze.
Die Verantwortung von Systemiker:innen in der Praxis
Mit anderen Worten: Ich sehe es als meine Pflicht als systemisch arbeitende Person, die gesellschaftlichen und strukturellen Aspekte von Xenophobie zu benennen.
In der Praxis bedeutet dies, dass wir als Systemiker:innen nicht nur in familiären oder beruflichen Kontexten arbeiten, sondern auch die größeren gesellschaftlichen Kräfte und Narrative einbeziehen müssen, die u.a. Xenophobie nähren. Wir sind aufgefordert, die Strukturen der Macht und Diskriminierung zu hinterfragen, die Vorurteile und Ängste verstärken und festigen, und Klient:innen dabei zu unterstützen, neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Nur so kann ein wirklich nachhaltiger, (auch gesellschaftlicher) Veränderungsprozess stattfinden.
Xenophobie systemisch "interpretiert"
Um den Umgang mit Xenophobie in der Praxis zu erleichtern, halte ich es nun noch für sinnvoll den Begriff, neben der strukturellen Einordnung, noch anhand von vier weiteren Beispielen systemisch zu interpretieren.
Xenophobie als dysfunktionale Schutzstrategie
Im systemischen Sinne lässt sich Xenophobie auch als ein (dysfunktionaler) Bewältigungsmechanismus verstehen, mit Angst oder Kontrollverlust umzugehen. Die Ausgrenzung des „Fremden“ kann eine Abwehrreaktion auf Unsicherheit oder ein erlerntes Muster aus dem eigenen Herkunftssystem sein.
„Fremd“ als Zuschreibung
Aus konstruktivistischer Perspektive ist das, was als „fremd“ empfunden wird, keine objektive Tatsache, sondern ein Ergebnis von Unterscheidungen und Bedeutungszuschreibungen. Systemiker:innen würden hier fragen: „Was genau ist es, das als fremd empfunden wird – und was macht diese Zuschreibung möglich oder nötig?“
Narrative Perspektive
Fremdenfeindliche Überzeugungen basieren oft auf starren, verallgemeinernden Erzählungen über Gruppen. Systemische Therapie arbeitet damit, solche Narrative sichtbar, überprüfbar und veränderbar zu machen.
Mehrgenerationale Perspektive
Was wurde in der Familie oder Kultur über „die anderen“ erzählt? Welche Ängste, Traumata oder Loyalitäten wirken da noch unbewusst nach? Für wen war es nützlich, dass „die anderen“ Schuld waren? Zu wem gehört die Angst?
Dieser Blogartikel soll dazu beitragen, ein Bewusstsein für die strukturellen, systemischen Dimensionen von Xenophobie zu schaffen und auf die Herausforderungen hinzuweisen, die sie in systemischen Kontexten mit sich bringt. Es ist von zentraler Bedeutung, dass wir als systemische Fachkräfte die gesellschaftlichen Strukturen reflektieren, die Diskriminierung und Exklusion aufrechterhalten, und uns aktiv damit auseinandersetzen.
Indem wir diese Themen in unserer Arbeit berücksichtigen, können wir einen Beitrag zu einer inklusiveren und gerechteren Gesellschaft leisten.
Dieser Beitrag ist Teil der Serie „Systemische Begriffe kurz erklärt“. Schreibt mir gern, ob der Artikel für Euch hilfreich war oder lasst mich wissen, wenn Euch etwas fehlt oder zu kurz gekommen ist.