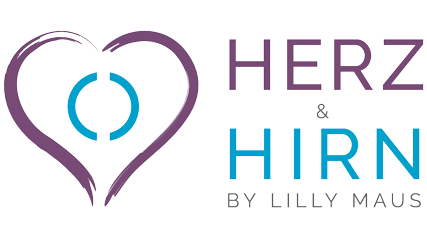Katastrophisieren: Warum denke ich immer in Worst-Case-Szenarien – und was kann ich dagegen tun?
Katastrophisieren oder wenn das Kopfkino Amok läuft

Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
Murphys Gesetz
Film ab für den Katastrophenfilm im Kopfkino
Freitagabend, kurz vor Feierabend. Eine Nachricht von der Chefin: „Bevor ich es vergesse, ich möchte nächste Woche mal über Ihre Projekte sprechen. Insbesondere das von Kunde Maier-Schulze – der hat mich heute angerufen. Bitte stellen Sie uns einen Termin ein.“
Und schon läuft das Kopfkino los: „Das kann nichts Gutes heißen. Warum ruft der Kunde nicht mich direkt an? Was, wenn ich etwas übersehen habe? Bedeutet das Ärger? Was, wenn ich deswegen meinen Job verliere?“
Ein kurzer Gedanke – und ehe Sie sich versehen, sind Sie mitten in einem inneren Katastrophenfilm.
Warum wir katastrophisieren – und was dahinter steckt
Evolutionsbedingt auf „Worst Case“ programmiert
Dieses Denken in „Was, wenn …?“-Szenarien kennen viele Menschen. Der sogenannte Negativity Bias ist eine Grundeinstellung unseres Gehirns – evolutionsbedingt war sie einmal überlebenswichtig. Sie half, Risiken, die den sicheren Tod bedeuteten, vorzubeugen.
Nur wer sich im Sommer eine Höhle suchte, um im Winter Schutz zu haben, überlebte. Nur wer jagte, bevor sich die Tiere verkrochen, hatte genug zu essen. Und nur wessen Nervensystem auf den Säbelzahntiger mit einer Flut aus Stresshormonen reagierte, war schnell oder aggressiv genug, um der Gefahr zu begegnen.
Heute ist es vielleicht eine E-Mail von der Chefin, Kopfschmerzen, die auf einen Gehirntumor hindeuten könnten, oder das Schweigen eines geliebten Menschen – auf all diese reagiert unser Gehirn mit denselben chemischen Reaktionen: Cortisol, Adrenalin, Alarmmodus. Auch wenn es längst nicht mehr um Leben und Tod geht, funktioniert der Mechanismus noch immer wie damals.
Wenn das Gehirn beginnt, ständig den schlimmstmöglichen Ausgang zu erwarten, entsteht Leidensdruck. In der Psychologie sprechen wir dann vom Katastrophisieren – einer sogenannten kognitiven Verzerrung.
Chand, S. P., Kuckel, D. P. & Huecker, M. R. schreiben 2025 in Cognitive Behavior Therapy. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing:
Catastrophizing: Focusing on the worst possible outcome, however unlikely, or thinking that a situation is unbearable or impossible when it is just uncomfortable.
Chand, Kuckel & Huecker, 2025
Das Muster ist immer dasselbe: Das Gehirn füllt eine Wissenslücke mit der schlimmsten aller Möglichkeiten.
Lassen Sie uns Ihren individuellen Prozess starten.
Nutzen Sie mein Angebot für ein kostenfreies 15-minütiges Erstgespräch.
Ursachen und Folgen von Katastrophisieren
Katastrophisieren aus Sicht der Kognitiven Verhaltenstherapie
Katastrophisieren wirkt, als würde das Gehirn ein Sicherheitsprogramm abspielen, das sich verselbstständigt hat. Es sucht nach Lösungen, findet aber keine – weil das Problem nur in der Vorstellung existiert.
Studien zeigen, dass dieses Denken eng mit Depressionen und Angststörungen verknüpft ist (vgl. Pike, A. C., Serfaty, J. R. & Robinson, O. J. (2021). The development and psychometric properties of a self-report Catastrophizing Questionnaire. Royal Society Open Science, 8(1), 201362.). In der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) gilt Katastrophisieren daher als erlerntes Denkmuster, das auf tieferliegenden Glaubenssystemen basiert.
Diese sogenannten Grund- und Zwischenüberzeugungen entstehen laut Chand, Kuckel & Huecker (2025) aus Lebenserfahrungen und beeinflussen, wie wir Situationen wahrnehmen und bewerten. Sie bilden die Grundlage automatischer Gedanken und strukturieren unsere Informationsverarbeitung.
In der Kognitiven Verhaltenstherapie wird zwischen zwei Ebenen unterschieden:
- Kernüberzeugungen: Tief verankerte, oft starre Annahmen über sich selbst und die Welt wie „Ich bin nicht liebenswert.“, „Ich bin unzulänglich.“, „Die Welt ist ein gefährlicher Ort.“
- Zwischenüberzeugungen: Daraus abgeleitete Regeln, Einstellungen und Erwartungen wie „Ich muss immer perfekt sein, um anerkannt zu werden.“, „Um akzeptiert zu werden, sollte ich anderen immer gefallen.“, „Ich sollte in allem, was ich tue, hervorragend sein, um als ausreichend angesehen zu werden.“, „Es ist am besten, so wenig wie möglich mit Menschen zu tun zu haben.“
Die KVT basiert auf der Beobachtung, dass dysfunktionale automatische Gedanken, die übertrieben, verzerrt, falsch oder auf andere Weise unrealistisch sind, eine bedeutende Rolle in Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Probleme spielen.
Katastrophisieren als Überlebensstrategie
Was die KVT als Denkverzerrungen und mitverantwortlich für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Probleme betrachtet, sehen wir sie in der systemischen Traumatherapie vor allem in ihrer Funktion: als einst kompetente Überlebens- und Schutzstrategien eines überforderten Nervensystems – entstanden in Situationen, in denen Sicherheit, Bindung, Autonomie oder Selbstwert bedroht waren.
Das kann durch frühe emotionale Vernachlässigung, wiederkehrende Überforderung, Gewalt oder einschneidende Erlebnisse wie den Tod eines Elternteils, eine schwere Krankheit oder anhaltende familiäre Unsicherheit entstehen.
Statt als Erwachsene das eigene Handlungspotenzial zu erkennen, greifen Betroffene unbewusst auf frühkindliche Erfahrungszustände zurück, in denen sie machtlos waren.
So konserviert sich das innere Gefühl einer Katastrophe – und wird bei jeder neuen Unsicherheit reaktiviert.
Die systemische Traumatherapie liefert damit eine Erklärung für die Entstehung der oben beschriebenen Glaubenssysteme und der daraus entstandenen Coping-Mechanismen:
Was damals Schutz bot und im Dort und Damals hoch funktional war, wird später zu einem inneren Glaubenssystem, das im Hier und Heute Leid erzeugen kann.
Aus traumatherapeutischer Sicht sind diese Überzeugungen daher keine simplen Denkfehler, sondern Spuren früher Anpassung – Spuren, die gesehen, verstanden und integriert werden wollen, statt sie als „kaputt“ zu bezeichnen oder „wegmachen“ zu wollen.
Stress, Angst, Panik oder Erschöpfung – der Körper schlägt Alarm
Egal, ob evolutionsbedingt, kognitiv erlernt oder traumatisch verankert – Katastrophisieren aktiviert immer dieselbe körperliche Reaktion: Stress. Das sympathische Nervensystem schaltet auf Überlebensmodus: Herzschlag und Muskelspannung steigen, die Atmung wird flach.
So wird ein neutraler Reiz – eine E-Mail, ein ausbleibender Anruf, ein Symptom – zum inneren Notfall. Der Körper reagiert nicht auf die Gegenwart, sondern auf die Vergangenheit.
Das erklärt, warum Katastrophisieren nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich spürbar ist – als Anspannung, Schlafstörung, Reizbarkeit oder Erschöpfung. Das Nervensystem hält fest, was einmal lebenserhaltend war – bis wir ihm neue, sichere Erfahrungen anbieten.
Wie kann ich Katastrophendenken stoppen?
Aus Sicht der systemischen Traumatherapie wird deutlich: Katastrophisieren lässt sich nicht einfach abstellen. Das Glaubenssystem, das dem Katastrophendenken zugrunde liegt, ist ein komplexer Schutzmechanismus zur Vermeidung von Kontrollverlust. Diese Angst ist mitunter so groß, dass sie sich in körperlichen Symptomen wie Kopfschmerzen, Durchfall, Herzrasen, Reizbarkeit und schneller Ermüdung manifestiert.
Was also tun gegen Katastrophenphantasien? Positiv Denken allein reicht hier nicht. Aber Sie können lernen, den Automatismus zu unterbrechen, einen Ausgleich herzustellen und Ihr Gehirn wieder in die Gegenwart zu holen. Dabei helfen drei Schritte:
1. Stopp-Übung
Erkennen Sie den Moment, in dem Sie katastrophisieren. Sagen Sie sich laut oder leise „Stopp!“ Stellen Sie sich dabei beispielsweise ein Stoppschild vor. Das klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, es braucht ein wenig Übung. Wichtig ist es erstmal die negative Gedanken-Gefühls-Handlungs-Kette zu unterbrechen um nicht durch impulsives Handeln genau die Katastrophe herbeizuführen, die eigentlich verhindert werden soll -nur um sich dann bestätigt in der eigenen Katastrophenannahme bestätigt zu fühlen.
Allein diese Unterbrechung kann Ihr Nervensystem schon etwas beruhigen -u.a. weil sie sich als handlungskompetent erleben.
2. Re-Fokussieren
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt. Bewegen Sie Ihre Füße, spüren Sie den Boden, sagen Sie sich Ihren Namen, ihr Alter und das heutige Datum auf. Machen Sie sich klar, dass sie nicht in der Vergangenheit sind sondern in der Gegenwart und dass sie viele Fähigkeiten haben, die Ihnen helfen Probleme zu lösen. So merkt das Gehirn: Ich bin hier. Ich bin sicher.
Um sich noch etwas mehr zu beruhigen, können Sie auch verschiedene Techniken, wie das 4er-Atmen oder die 5-4-3-2-1-Methode anwenden.
3. Raus aus dem Kopf, rein ins Handeln
Wenn Sie wieder etwas ruhiger sind, können Sie die Teile Ihres Gehirns aktivieren, die für logisches Denken zuständig sind – den präfrontalen Kortex.
Das gelingt am besten, wenn Sie sich konkrete Fragen stellen oder Dinge aufschreiben:
- Konzentrieren Sie sich auf die Fakten.
Was weiß ich wirklich – und was interpretiere ich nur?
Wie wahrscheinlich ist mein Worst Case auf einer Skala von 0 bis 10? - Schreiben Sie Ihre Gedanken auf.
Manchmal hilft es, das Gedankenchaos aus dem Kopf aufs Papier zu bringen.
Erstellen sie ein Gedankenprotokoll. - Spielen Sie das Worst-Case-Szenario bewusst zu Ende – und entwickeln Sie einen Plan.
Fragen Sie sich: Was würde ich konkret tun, wenn das wirklich passiert?
So holen Sie sich die Kontrolle zurück, die das Katastrophisieren Ihnen genommen hat.
Hierfür kann es hilfreich sein, eine adaptierte WOOP-Sequenz (Wish–Outcome–Obstacle–Plan) zu nutzen. Ursprünglich wurde WOOP von der Psychologin Gabriele Oettingen entwickelt, um erfolgreich Ziele zu erreichen. Meines Erachtens eignet sich die Methode auch hervorragend um in Ihrem Kopf dem „Was wäre, wenn alles schiefgeht?“ (Worst case senario) ein „Und wenn es passiert, dann tue ich dieses oder jenes“ (Plan) entgegenzusetzen. Das holt das Gehirn aus der Problemzentrierung und führt es in die Lösungsfokussierung.
- Wish (Wunsch): Welches neue Verhalten wünsche ich mir in Situationen in denen ich nur den Worst case sehe und Panik bekomme?
- Outcome (Ergebnis): Was würde ich tun? Wie würde sich das anfühlen?
- Obstacle (Hindernis): Ich vertraue mir selbst noch nicht und lande in meinen Muster: „Aber was, wenn doch alles schief geht?„
- Plan: „Wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, was genau würde ich dann tun?„
Nehmen Sie sich Zeit diesen „Wenn-Dann-Plan“ zu erstellen. Hier finden Sie ein Arbeitsblatt, dass Sie dabei unterstützt.
Die imaginative Konfrontation mit dem Worst-Case und das ausarbeiten verschiedener Lösungsideen, hilft Ihnen dabei, tatsächlich besser vorbereitet zu sein und entlastet gleichzeitig ihr Nervensystem indem es ihnen wirklich Kontrolle über eine zuvor als unsicher erlebte Situation gibt.
So erhöhen sie die Chance auf eine neue Erfahrung, mit positivem Ausgang. Je häufiger sie solche Erfahrungen machen, desto eher lernt ihr System zu vertrauen und braucht das Worst-Case-Szenario nicht mehr aufzurufen, um dem vermeintlichen Kontrollverlust zu entgehen.
So wird aus dem Worst Case ein What Now? – aus Ohnmacht ein Gefühl von Handlungsspielraum und Selbstwirksamkeit.
Wenn Sie merken, dass Katastrophengedanken Sie dauerhaft begleiten, Schlaf oder Konzentration stören oder Ängste zunehmen, holen Sie sich Unterstützung.
Systemische Traumatherapie kann helfen, alte Muster zu verstehen, das Nervensystem zu stabilisieren und neue, sichere Erfahrungen zu machen.
Herzlich Ihre
Lilly Maus