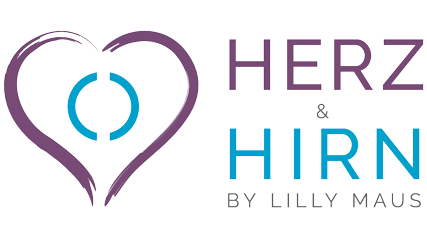Systemisch R wie Reframing
Systemische Begriffe kurz erklärt

Ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert.
Thomas Edison
Mit anderen Worten: “Alles eine Frage der Perspektive”.
Der Begriff Reframing (en. frame = Rahmen) wird im Deutschen als „Umdeutung“ bezeichnet. Im therapeutischen Kontext geht es darum, dem Geschehen (Ereignis, Verhalten, Aussagen) eine andere, hilfreichere Bedeutung zu geben, indem die Perspektive (der Kontext, die Beziehung zu etwas oder die innere Haltung) verändert wird.
Reframing hilft, starre, problemzentrierte Sichtweisen und Glaubenssätze zunächst ins Wanken zu bringen, um Veränderung zu initiieren und zu neuen Sichtweisen anzuregen. Anstatt eine Eigenschaft oder ein Verhalten als Defizit zu betrachten, wird eine alternative Bedeutung ergänzt, die Ressourcen und Potenziale sichtbar macht.
In der systemischen Therapie kann Reframing als ein Mittel der „Verstörung“ des Klient:innensystems betrachtet werden schreiben Wolfgang Senf, Michael Broda und Bettina Wilms in ihrem 2013 bei Thieme erschienen Buch „Techniken der Psychotherapie„. Und weiter:
Diese Begrifflichkeit geht auf Maturanas Autopoiesekonzept zurück, dem gemäß biologische Systeme selbstregulierend sind und von außen nicht [gezielt] gesteuert, sondern lediglich "perturbiert" werden können. Reframing ist somit auch in der Systemischen Therapie ein Hilfsmittel der Veränderung. Aber nicht im Sinne einer gezielten Hinführung des Klienten zu einem vom Therapeuten vorhersehbaren -und in der Regel gemeinsam vereinbarten- Ergebnis, sondern als ein Angebot an Klienten, dass sie zur Modifikation von Regeln im System anregen soll, ohne dass Therapeuten für sich beanspruchen, diesen Prozess in Ihrem Sinne dirigieren zu können.
Senf, W. et al. (2013)
Gleichsam gilt aus systemischer Perspektives Verhalten stehts als kontextspezifisch. Systemisch gesehen ist jedes Verhalten, jedes Symptom und jede Emotion eine Antwort auf einen Kontext. Wenn sich dieser Kontext verändert – also der „Rahmen“, in dem wir etwas betrachten – verändert sich auch dessen Bedeutung.
Ein Verhalten, das in einem System als störend erlebt wird, kann in einem anderen als sinnvoll erscheinen. Verhalten, dass im „Hier und Heute“ als störend oder dysfunktional erlebt wird, kann im „Dort und Damals“ eine kompetente Überlebensstrategie gewesen sein.
Ein verständnisvoller, mitfühlender Blick auf das eigene „so geworden sein, wie wir sind“ und die Klarheit darüber, dass wir stets die Wahl haben, unsere Zukunft nicht durch die Vergangenheit bestimmen zu lassen, ermöglicht es den bisherigen Rahmen unserer Möglichkeiten zu verlassen und uns selbst in ein neues Licht zu stellen.
Lassen Sie uns Ihren individuellen Prozess starten.
Nutzen Sie mein Angebot für ein kostenfreies 15-minütiges Erstgespräch.
Reframing in der Systemischen Praxis
Reframing zeigt seine Wirkung weniger als Technik, sondern vielmehr als ein Erfahrungsprozess: Bedeutung verändert sich im Erleben, nicht im Denken.
Beispiel
Disclaimer: Alle Beispiele sind frei erfunden und zum Zwecke der Begriffserläuterung konstruiert. Sie bilden weder die Wirklichkeit noch die Komplexität der menschlichen Psyche ab, da sie einseitig einen Begriff in den Fokus nehmen. Schaubilder wurden entweder eigens für die Fälle erstellt oder inhaltlich maßgeblich verfremdet.
Situation
Jonas, 32, arbeitet in einem internationalen Konzern im oberen Management. Er ist der jüngste in dieser Führungsebene – ehrgeizig, diszipliniert, hochkompetent. Sein Umfeld hält ihn für erfolgreich, doch innerlich fühlt er sich getrieben.
Wenn sein Handy klingelt, reagiert sein Körper mit Panik. Trotzdem kann er es nicht ausschalten. Urlaub stresst ihn – zu viel Unvorhersehbares, zu viele Menschen, zu wenig Kontrolle. Und vor allem: zu viel Leerlauf, in dem sich das Gedankenkarussell dreht.
Obwohl er finanziell abgesichert ist, fällt es ihm schwer, Geld für „Unnötiges“ auszugeben. „Ich kann mich einfach nicht entspannen“, sagt er. Seine Kindheit beschreibt er als „eigentlich ganz normal“. Nur die Schule war ein Problem: Jonas hatte eine ausgeprägte Lese-Rechtschreib-Schwäche, konnte sich kaum konzentrieren, wenn ihn ein Thema nicht interessierte, und fiel zweimal durch wichtige Prüfungen.
„Eigentlich habe ich mich ja komplett durch die Schule gemogelt – meine Noten waren immer besser, als sie es ohne Nachteilsausgleich gewesen wären“, erzählt Jonas. „Ehrlich gesagt war mir das alles egal. Die Streber von damals stehen heute auch nicht besser da als ich.“
Systemische Interventionen
1. Hypothesenbildung
Aus systemisch-biografischer Perspektive entsteht die Hypothese, dass Jonas in seiner Schulzeit wiederholt das Gefühl von Kontrollverlust, Beschämung und Nicht-genügen erlebt hat.
Die fehlende Vergleichbarkeit mit seinen Mitschülern – das Gefühl, „außerhalb der normalen Bewertung zu stehen“ – hat eine tiefe Form von Unsicherheit erzeugt. Das schulische System vermittelte ihm unbewusst: „Du bist so leistungsschwach, dass wir dich nicht einmal nach denselben Maßstäben bewerten können.“ und „egal welche Note Du erhältst, Du kannst Dir nie sicher sein, ob Du wirklich gut warst“.
Als Schutzreaktion auf einen daraus resultierenden instabilen Selbstwert begann Jonas, sich innerlich von den „Strebern“ abzugrenzen. Er entwickelte eine Haltung, die schulische Leistung abwertet – und gleichzeitig in ihm ein unbewusstes Gegenprogramm aktivierte: Erfolg um jeden Preis.
Im Erwachsenenalter übersetzt sich diese Dynamik in ein extremes Bedürfnis nach Status, Kontrolle und finanzieller Überlegenheit – als Beweis, „es doch geschafft zu haben“ und sehr wohl „etwas wert“ zu sein. Doch der Preis dafür ist hoch: ständige Anspannung, Überforderung und die Unfähigkeit, sich sicher zu fühlen, selbst wenn objektiv alles gut ist.
2. Den bisherigen Rahmen würdigen
Im therapeutischen Gespräch wird Jonas nicht korrigiert, sondern ernst genommen in seiner Wahrnehmung.
Seine Strategien werden nicht pathologisiert, sondern zunächst als verständlich und nachvollziehbar betrachtet.
Das Schulsystem legte den Fokus auf Kompetenzen, die nicht zu seinen Stärken gehörten. Über Jahre war Jonas mit der Erfahrung konfrontiert, den Erwartungen des Systems nicht gerecht werden zu können. Anstatt seine Potentiale zu fördern und ihm Räume zu geben, in denen er sich als kompetent erleben konnte, wurden seine Defizite überbetont – und genau dort immer wieder gespiegelt. So fehlte das korrigierende Feedback, das Selbstvertrauen entstehen lässt. Stattdessen verfestigte sich ein inneres Narrativ von „Ich bin nicht genug“ – ein Satz, der sich tief einprägt, wenn Leistung über Wert entscheidet.
Damit wird die Funktion seines Verhaltens deutlich: Kontrolle, Perfektion und nachweißlicher Erfolg als Schutz vor Ohnmacht und dem Gefühl versagt zu haben.
Jonas’ extreme Leistungsbereitschaft, sein Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit und sein wenig entspannter Umgang mit Fehlern und unvorhersehbaren Situationen sind ausgesprochen kluge und kompetente Versuche, sich vor dem alten Gefühl des Versagend und Hilflosigkeit zu bewahren. Diese Strategie „gelingt“ für eine Weile – er ist objektiv überdurchschnittlich erfolgreich doch sie hat auch einen Preis: er dreht permanent auf Vollgas, gönnt sich keine Pausen, darf sich keinen Fehler erlauben und findet keine Ruhe -das Hamsterrad dreht sich immer schneller und schneller -bis ihn die Panik aus der Spur nimmt und ihn zwingt für einen Moment inne zu halten.
So werden seine Panikattacken vom Feind zum Signal – ein Hinweis darauf, dass Jonas’ System an einer Grenze angekommen ist und er neue Form von Sicherheit suchen darf.
3. Die Bedeutung verschieben
Im nächsten Schritt erfolgt das eigentliche Reframing.
Die Angst wird nicht länger als etwas verstanden, was Jonas unbedingt loswerden will, damit er wieder „ordentlich funktioniert, sondern als Erinnerung seines Systems, nach neuen, nachhaltigeren Formen der inneren Sicherheit zu suchen. Jonas lernt, dass sein Selbstwert nicht davon abhängt, dass er Leistung bringt.
Diese neue Rahmung verändert die Haltung: Jonas beginnt zu verstehen, dass die Panik nicht gegen ihn arbeitet, sondern für ihn. Sie zwingt ihn, innezuhalten – etwas, das er sonst nie tut – und sich mit sich selbst und seinem „Geworden-Sein“ auseinander zu setzen, seinem früheren Selbst mit all seinen Gefühlen der Unzulänglichkeit zu begegnen, die Ungerechtigkeiten von damals zu betrauern und sich auf eine gesunde Art von der Be- und Entwertung des Systems zu distanzieren -ohne die anderen abzuwerten und sich selbst zu überhöhen.
4. Ressourcen und Alternativen aktivieren
Auf dieser Grundlage arbeiten wir Mini-Reframings für seinen Alltag:
Immer dann, wenn Jonas bemerkt, dass er sich für einen vermeintlichen Fehler verurteilt und in Panik gerät, ersetzt er den Satz „Ich darf mir keinen Fehler leisten“ oder „ich muss der Beste sein“ durch:
„Fehler sind menschlich. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Das ist okay.“
In den gemeinsamen Sitzungen experimentieren wir mit körperorientierten Interventionen, um Sicherheit nicht über Kontrolle, sondern über Präsenz zu erleben – etwa durch Atemarbeit, Erdung und kurze Imaginationsreisen in Situationen, in denen er sich ruhig und kompetent erlebt hat.
So verschiebt sich das innere Referenzsystem:
Von „Ich bin nur wertvoll, wenn ich perfekt und allen anderen überlegen bin“
zu „Meine Existenz hängt nicht davon ab, dass ich etwas leiste -ich existiere auch wenn ich nur atme.“
5. Kontextualisierung und Integration
In der vertiefenden Arbeit geht es nun darum, das alte innere Narrativ – „Ich muss etwas darstellen, der Beste sein, um etwas wert zu sein“ – in einen größeren biografischen Zusammenhang zu stellen.
Jonas erkennt, dass sein früherer Schulhass Ausdruck einer tiefen Aversion gegen ein System war, das ihn wiederholt entwertet hat. Nicht, weil er nichts lernen wollte, sondern weil das, was dort zählte, nichts mit ihm und seinen tatsächlichen Begabungen zu tun hatte.
Sein selbstausbeuterisches Leistungsverhalten wird im therapeutischen Prozess als Bewältigungsstrategie verstanden – ein Versuch, sich vor dem Gefühl zu schützen, nicht wertvoll zu sein.
Seine Tendenz, andere abzuwerten, war ein unbewusster Versuch, den eigenen Selbstwert zu stabilisieren.
Und seine Unentspanntheit in ungewohnten Situationen zeigt sich als Stressreaktion seines Systems auf alles, was schwer kontrollierbar ist und damit die alte Gefahr birgt, zu versagen.
Jonas beginnt zu verstehen: Diese Muster waren kluge Reaktionen auf ein Umfeld, das einen übermäßigen Fokus auf Leistung legte und es nicht vermochte, seinem kindlichen Selbst das Gefühl zu vermitteln, unabhängig von seiner Leistung ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft zu sein.
Ich fasse in einer Sitzung zusammen:
„Sie haben damals gelernt, dass Leistung über Wert entscheidet. Heute dürfen Sie erleben, dass Ihr Wert nicht verhandelbar ist.“
Dieser Satz markiert den Übergang von Selbstdisziplin zu Selbstannahme.
Reframing zeigt hier seine tiefste Wirkung: Das Vergangene verliert nicht seine Bedeutung – es bekommt eine neue.
Jonas muss nichts loslassen, sondern darf anerkennen, dass sein alter Rahmen ihm einst Halt gegeben hat und der neue ihm Würde schenkt und entspannen lässt.
Was nimmt Jonas mit?
Jonas erkennt, dass sein innerer Antreiber – der unstillbare Drang, immer der Beste sein zu müssen – ihn lange geschützt hat.
Er begreift, dass sein Bedürfnis nach Kontrolle, Status und Erfolg Überlebensstrategien eines Kindes sind, das nie sicher sein konnte, dass es gut genug ist.
Mit jedem Reframing-Schritt lernt er, seinen Wert nicht mehr im Außen zu bestätigt zu bekommen. Er hört auf sich und andere zu bewerten und beginnt sich für das Einzigartige in jeder Geschichte zu interessieren.
Statt seine Energie in äußeren Erfolg zu investieren, beginnt Jonas jeden Moment wertzuschätzen, in dem er spürt, dass sein Dasein nicht von Leistung abhängt.
Vielleicht erkennen Sie sich in manchen Anteilen von Jonas wieder. In der ständigen Selbstkritik, im Gefühl, nie ganz genug zu sein – oder im Drang, immer noch ein bisschen mehr leisten zu müssen. Äußerlich läuft alles rund, und doch fühlt sich Erfolg nie nach Erfüllung an.
Manchmal genügt eine kleine Verschiebung der Perspektive, um das eigene Erleben neu zu verstehen. Daraus wiederum erwachsen neue Möglichkeiten und Handlungsspielräume.
Denn Veränderung beginnt nicht dort, wo wir härter werden, sondern wo wir milder mit uns selbst umgehen.
Wenn Sie spüren, dass Sie alte Bewertungen loslassen und alternative Bedeutungen finden möchten, begleite ich Sie gern dabei.
Herzlich Ihre
Lilly Maus