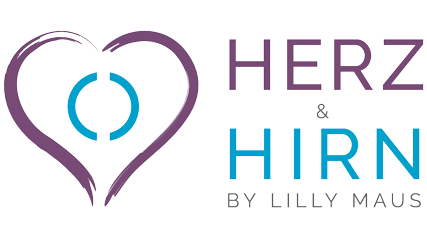Systemisch K wie Kognitive Verzerrungen
Systemische Begriffe kurz erklärt

Du darfst nicht alles glauben, was du denkst.
Alexander Bojcan alias Kurt Krömer
Begriffsdefinition
Kognitive Verzerrungen (englisch cognitive biases) sind systematische Denkfehler, die unsere Wahrnehmung und unser Urteilsvermögen beeinflussen. Sie entstehen, weil unser Gehirn Informationen vereinfacht und filtert, um Energie zu sparen und schnelle Entscheidungen zu ermöglichen. Evolutionär gesehen war das überlebenswichtig – heute sorgt es oft für Stress, Missverständnisse oder Selbstzweifel.
Der Psychiater Aaron T. Beck, Begründer der Kognitiven Therapie, betont in seinem Buch Cognitive Therapie and the Emotional Disorders:
Verzerrte Gedankenmuster sind ein zentraler Faktor bei der Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen.
Beck, A. T. 1979
Unser Gehirn filtert täglich riesige Informationsmengen – emotional, aufmerksamkeitsbezogen oder gedanklich. Um Entscheidungen zu erleichtern, greift es automatisch auf vereinfachende Regeln und Muster zurück. Diese sogenannten kognitiven Verzerrungen, auch Cognitive Biases oder Cognitive Distortions genannt, sind evolutionär sinnvoll. Das Problem ist, dass sie oft zu einer verzerrten Wahrnehmung, Fehlinterpretationen oder negativen Stimmungen führen.
Ein grundlegender Mechanismus, der vielen dieser Verzerrungen zugrunde liegt, ist der Negativitätsbias. In der Urzeit überlebten die Pessimisten, die Gefahren sahen und vorsorgten, während Optimisten eher gefressen wurden oder verhungerten. Die Gene der Pessimisten wurden weitergegeben. Heute leben wir jedoch in einer weit weniger gefährlichen Welt, und diese urzeitliche Prägung kann uns das Leben unnötig schwer machen.
Kognitive Verzerrungen in der Systemischen Praxis
In der Therapie begegnen mir solche Denkfallen fast täglich. Sie sind menschlich – aber sie können Konflikte verstärken, Selbstwert schwächen und Beziehungen belasten. In meiner Arbeit schaue ich mit Klient:innen deshalb bewusst auf solche Muster und lade ein, alternative Sichtweisen zu entwickeln, um neue Handlungsräume zu öffnen.
Die Art und Weise, wie wir denken, beeinflusst unsere Interaktionen mit anderen und umgekehrt. Wenn wir aus Einzelerlebnissen allgemeine Wahrheiten ableiten oder die Gedanken anderer erraten, entstehen leicht Missverständnisse und unnötige Konflikte.
In meiner Arbeit als systemische Therapeutin nutze ich das Wissen über kognitive Verzerrungen, um Klient:innen dabei zu unterstützen, ihre Denkmuster zu entwirren. Anstatt die Gedanken einfach nur zu „korrigieren“, geht es darum, sie in einen größeren Kontext zu stellen und zu hinterfragen. Ziel ist es, die Fähigkeit zu stärken, innezuhalten, die eigene Wahrnehmung zu reflektieren und neue Perspektiven zu finden. Es gibt nicht nur eine einzige Wahrheit, sondern viele Blickwinkel, die wir einnehmen können.
Wenn das für das für Sie zwar logisch klingt, Sie aber dennoch den Abkürzungen ihres Gehirns immer wieder auf den Leim gehen unterstütze ich Sie gerne dabei nachhaltige Wege zu finden ihre Denkmuster zur verändern.
Lassen Sie uns Ihren individuellen Prozess starten.
Nutzen Sie mein Angebot für ein kostenfreies 15-minütiges Erstgespräch.
Beispiel
Disclaimer: Alle Beispiele sind frei erfunden und zum Zwecke der Begriffserläuterung konstruiert. Sie bilden weder die Wirklichkeit noch die Komplexität der menschlichen Psyche ab, da sie einseitig einen Begriff in den Fokus nehmen. Schaubilder wurden entweder eigens für die Fälle erstellt oder inhaltlich maßgeblich verfremdet.
Situation
Maria, eine 35-jährige Marketingexpertin, hat eine Präsentation vor dem Vorstand gehalten. Obwohl die Mehrheit positiv reagierte und sich über das Ergebnis freute, bemerkte sie, dass einer der Vorstände – Herr Müller – während ihrer Ausführungen skeptisch schaut. Maria verfällt in einen Teufelskreis aus negativen Gedanken und verhaspelt sich: „Wahrscheinlich fand Herr Müller alles schlecht, meine Präsentation war ein totaler Reinfall, jetzt denken alle ich wäre eine Idiotin, ich habe meine Karriere ruiniert.“
Systemische Interventionen
Kognitive Verzerrungen aufdecken
Ziel: Maria lernt, die kognitiven Verzerrungen, die ihr Gehirn automatisch erzeugt, zu erkennen und somit zu entlarven.
Intervention: Mithilfe von systemischen Fragen unterstütze ich Maria dabei zu erkennen, dass es durchaus sein kann, dass sich die Situation ganz anders, als von ihr angenommen, darstellt: Angenommen Sie fragen Ihre Lieblingskollegin, wie wahrscheinlich es auf einer Skala von 0 % bis 100 % ist, dass Herr Müller wegen Ihrer Präsentation skeptisch geschaut hat, wie wäre ihre Einschätzung?
Ergebnis: Maria stellt fest, dass das Einzige, was sie wirklich weiß, der skeptische Blick war. Ihre Reaktion darauf, dass dieser mit ihrer Präsentation zu tun hat und dass ihre Karriere ruiniert ist – sind ihre Interpretationen, die durch emotionale Überwältigung zustande kamen.
Alternative Sichtweisen finden
Ziel: Maria erkennt die Mechanismen der kognitiven Verzerrungen Gedankenlesen, Schwarz-Weiß-Denken und Katastrophisieren, um alternative, realistischere Perspektiven zu entwickeln.
Intervention: Mittels Psychoedukation erkläre ich Maria die Funktionsweise der kognitiven Verzerrungen und nutze dann eine etwas überspitzte Darstellung zur Verdeutlichung: Sie können also die Gedanken von Herrn Müller lesen („Er fand Ihre Präsentation schlecht“) und die Präsentation war ja auch wirklich von Anfang bis Ende unterirdisch schlecht (Schwarz-Weiß-Denken) und weil Herr Müller der Einzige im Unternehmen ist, dessen Meinung etwas zählt, wird er sicher gerade schon Ihre Kündigung schreiben (Katastrophisieren). Da muss selbst Maria schmunzeln und meint: „Naja, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Ich habe von ganz vielen Kollegen ein positives Feedback bekommen und – wenn ich jetzt so darüber nachdenke – hat Herr Müller mich beim Rausgehen, glaube ich, sogar angelächelt.“
Ergebnis: Maria erkennt, dass ihr Gehirn selektiv den einen negativen Aspekt herausgefiltert hat, während sie die vielen positiven Rückmeldungen ignorierte. Sie spürt, wie die Anspannung nachlässt, als sie die Vielfalt der Reaktionen wahrnimmt und die Katastrophe im Kopf relativiert wird.
Emotionale Beweisführung auflösen
Ziel: Maria erkennt, dass Gefühle keine Tatsachen sind.
Intervention: Wir sprechen über emotionale Beweisführung. Maria fühlte sich, als wäre ihre Präsentation schlecht und sie eine Idiotin, also glaubte sie, es sei wahr. Ich erkläre ihr, dass Gefühle zwar wichtig sind, aber nicht zwangsläufig beweisen, dass etwas stimmt. Wir erarbeiten einen emotionalen Kompass: Was würde ein außenstehender Beobachter sehen, ohne die Gefühle?
Ergebnis: Maria kann ihre Gefühle als das wahrnehmen, was sie sind – eine Reaktion auf eine Interpretation – und nicht als unwiderlegbare Fakten.
Was nimmt Maria mit
Kognitive Verzerrungen gehören zum Menschsein dazu – aber sie müssen nicht das letzte Wort haben. Maria hat gelernt: Nicht jeder Gedanke ist ein Fakt, nicht jedes Gefühl ein Beweis. Das gibt ihr neue Sicherheit im Job und mehr Gelassenheit im Alltag.
Kognitive Verzerrungen im Selbstcoaching managen
Kognitive Verzerrungen können unseren Selbstwert untergraben und Beziehungen belasten. Aber die gute Nachricht ist, Sie können lernen, diese Denkabkürzungen zu managen. Ein erster Schritt ist es, die häufigsten Verzerrungen zu kennen und zu erkennen, wann sie bei Ihnen selbst oder bei anderen auftreten. Eine Übersicht über die sechs häufigsten Denkverzerrungen finden Sie in unserem Handout „Kognitive Verzerrungen“. Es gibt noch viele weitere Denkverzerrungen, aber die in unserem Handout beschriebenen sind für die therapeutische Arbeit die wichtigsten. Eine vollständige Liste finden Sie auf Wikipedia: Liste kognitiver Verzerrungen.
Hier sind einige Fragen, die Sie sich stellen können:
Katastrophisieren: „Was ist das realistischste Ergebnis, nicht das schlimmste?“ Und wenn das Schlimmste eintreten sollte, was kann ich dann ganz konkret tun? Eine Notfallstrategie entlastet das Gehirn.
Schwarz-Weiß-Denken: „Welche Zwischenstufen gibt es zwischen ‘alles richtig’ und ‘alles falsch’?“
Personalisierung: „Welche anderen möglichen Gründe könnte das Verhalten der anderen Person haben, die nichts mit mir zu tun haben?“
Gedankenlesen: „Was weiß ich wirklich, und was interpretiere ich nur?“
Selektive Wahrnehmung: „Welche drei positiven Aspekte gab es in der Situation, die ich vielleicht übersehen habe?“
Emotionale Beweisführung: „Gibt es objektive Hinweise oder andere Sichtweisen, die mein Gefühl infrage stellen?“
Wenn Sie merken, dass Ihre Gedanken dazu führen, dass Sie sich oft kleinmachen oder stressen: Lassen Sie uns gemeinsam hinschauen. Die Fähigkeit, die eigenen Gedanken bewusst wahrzunehmen und zu managen, ist der erste Schritt zur Veränderung hin zu mehr Gelassenheit, mehr Resilienz, weniger Stress, bessere Entscheidungen.