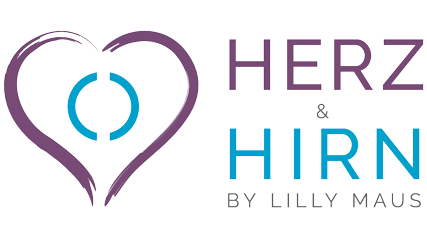Systemisch N wie Narrative Perspektive
Systemische Begriffe kurz erklärt
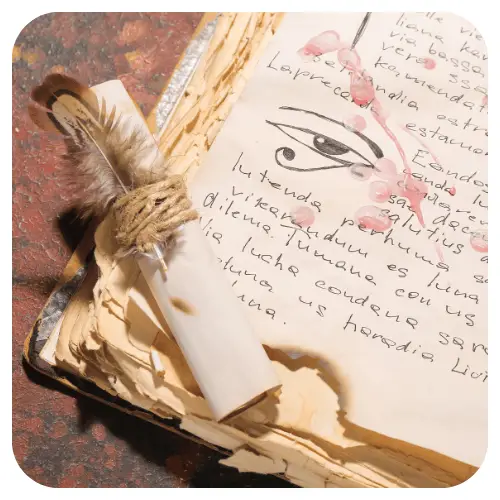
Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.
Max Frisch
Die narrative Perspektive ist ein Ansatz der systemischen Theorie und Praxis, der davon ausgeht, dass unsere Wirklichkeit durch Geschichten („Narrative“) konstruiert wird. Entscheidend ist, welche Geschichten das Leben eines Menschen bestimmen – welche Ereignisse betont und welche ausgeblendet werden. Nicht unsere Kindheit bestimmt unser Erleben in der Gegenwart. Die Gestaltung der Gegenwart bestimmt die Wirkung von Vergangenheiten und Zukünften.
White & Epston, die die narrative Perspektive maßgeblich geprägt haben, drücken es so aus:
Die narrative Perspektive geht davon aus, dass Menschen ihre Wirklichkeit durch die Geschichten konstruieren, die sie über sich selbst und ihre Erfahrungen erzählen. Diese Erzählungen sind nicht neutral, sondern gestalten die Wahrnehmung und das Handeln der Menschen in einem systemischen Kontext.
White & Epston, 1990, S. 13
Welche Ereignisse betonen wir? Welche blenden wir aus? Wie geben wir den Erlebnissen Bedeutung? Diese Fragen sind entscheidend, um zu verstehen, wie Menschen ihre Identität, ihre Herausforderungen und ihre Möglichkeiten wahrnehmen und gestalten. In der narrativen Perspektive ist die Annahme, dass es nicht nur eine „richtige“ oder „falsche“ Geschichte über unser Leben gibt. Vielmehr existieren verschiedene mögliche Geschichten, die eine andere Sicht auf die gleichen Ereignisse bieten können. Diese Vielfalt an Interpretationen eröffnet den Raum für Veränderung und neue Handlungsmöglichkeiten.
Die Auswirkungen von Narrativen
Die narrative Perspektive betont, dass unsere Wahrnehmung und unser Verhalten stark von den Geschichten abhängen, die wir über uns und die Welt erzählen. Das bedeutet: Eine Veränderung der Erzählweise kann zu einer Veränderung der Wahrnehmung und damit zu einer Veränderung des Lebensgefühls und der Handlungsmöglichkeiten führen.
Die Narrative Perspektive in der Systemischen Praxis
In der systemischen Praxis ist es daher wichtig, mit Klient:innen diese „Lebensgeschichten“ zu erkunden, sie zu hinterfragen und neu zu erzählen. Dabei geht es nicht nur darum, Probleme zu identifizieren, sondern auch darum, den Blick auf Ressourcen und ungenutzte Möglichkeiten zu richten. Als Therapeutin gehe ich mit einer Haltung des „Nicht-Wissens“ und der neugierigen Exploration vor, um gemeinsam mit den Klient:innen neue Narrative zu entwickeln, die Veränderung und Wachstum fördern.
Lassen Sie uns Ihren individuellen Prozess starten.
Nutzen Sie mein Angebot für ein kostenfreies 15-minütiges Erstgespräch.
Beispiel
Disclaimer: Alle Beispiele sind frei erfunden und zum Zwecke der Begriffserläuterung konstruiert. Sie bilden weder die Wirklichkeit noch die Komplexität der menschlichen Psyche ab, da sie einseitig einen Begriff in den Fokus nehmen. Schaubilder wurden entweder eigens für die Fälle erstellt oder inhaltlich maßgeblich verfremdet.
Situation
Thomas, 42 Jahre alt, kommt in meine Praxis, weil er sich irgendwie festgefahren fühlt – in seiner Arbeit und vor allem in seiner Beziehung zu seiner Mutter. Immer wieder erzählt er, dass er sich als Kind nie gut genug gefühlt hat. Die Mutter hatte immer hohe Erwartungen, und egal, was er tat, es war nie genug. Auch jetzt, als Erwachsener, fühlt sich Thomas ständig unter Druck. „Es ist, als würde ich immer wieder gegen eine Wand laufen, egal wie sehr ich mich bemühe“, sagt er.
Was mir direkt auffällt, ist, dass Thomas‘ ganze Erzählung von einem negativen Selbstbild geprägt ist. Die Geschichte, die er sich über sich selbst erzählt, ist die einer „unzulänglichen Version von mir“. Also schauen wir uns diese Geschichte genauer an und fragen uns: „Was passiert, wenn wir diese Erzählung mal neu denken? Was passiert, wenn wir die Geschichte umdrehen?“
Systemische Interventionen
Rekontextualisierung
In einer Sitzung mache ich Thomas einen Vorschlag: „Stell dir vor, du würdest die Erwartungen deiner Mutter nicht als Last, sondern als Trainingslager sehen – etwas, das dir geholfen hat, dich weiterzuentwickeln und dir Fähigkeiten zu geben, die dir heute in deiner Karriere zugutekommen. Was passiert, wenn du das mal so denkst?“ Es ist faszinierend, wie sich plötzlich ein Schalter umlegt. Thomas beginnt zu erkennen, dass er durch den Druck und die Anforderungen nicht nur überfordert wurde, sondern dass ihn diese Erlebnisse auch zu dem gemacht haben, was er heute ist – ein erfolgreicher Mann, der mit Herausforderungen umgehen kann
Externalisierung
Als nächstes lade ich ihn ein, das Gefühl der „Unzulänglichkeit“ von sich selbst zu trennen und es als „den ständigen Kritiker“ zu sehen. Wir sprechen davon, dass der Kritiker nicht Thomas ist, sondern etwas, das er beeinflussen kann. Ich frage: „Was würde es für dich bedeuten, diesen Kritiker nicht zu deinem täglichen Begleiter zu machen? Was passiert, wenn du ihm nicht mehr so viel Raum gibst?“ Thomas fängt an zu merken, dass er nicht dieser innere Kritiker ist und dass er tatsächlich die Kontrolle über den Dialog in seinem Kopf hat. Er gewinnt etwas Abstand und merkt, dass er nicht mehr so stark von diesem negativen Bild geprägt wird.
Arbeit mit Metaphern
Weil ich sie so sehr liebe, bringe ich noch eine Metapher ins Spiel. Wir stellen uns vor, dass seine berufliche Überlastung ein riesiges, undurchdringliches Netz ist, das ihn immer wieder einfängt. Ich frage ihn: „Wie wäre es, wenn du dir dieses Netz mal kleiner und durchlässiger vorstellst? Was würde passieren, wenn du dir das alles nicht mehr als unüberwindbare Barrieren denkst, sondern als Herausforderungen, die du aktiv gestalten kannst?“ Thomas beginnt, sich die Situation weniger als Blockade und mehr als etwas, das er beeinflussen kann, vorzustellen. Das verändert seinen Blickwinkel und gibt ihm ein Gefühl von Kontrolle
Was nimmt Thomas mit?
Am Ende dieser sehr intensiven Sitzung hat Thomas eine Alternativgeschichte entwickelt. Er sieht die Erwartungen seiner Mutter nicht mehr nur als erdrückend und belastend, sondern als Teil seiner Entwicklung, der ihn mit wichtigen Fähigkeiten ausgestattet hat. Statt sich als das Opfer seiner Kindheitserfahrungen zu sehen, erkennt er nun, dass er die Fähigkeit besitzt, diese Erfahrungen zu nutzen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Der „ständige Kritiker“ ist nicht mehr der Bestimmer seiner Realität, und Thomas fühlt sich deutlich freier und selbstbestimmter.
Ausblick
Thomas hat für sich eine neue Erzählung gefunden, die ihm Raum für Wachstum und Veränderung gibt. Und genau das ist der Kern der narrativen Perspektive: Es geht darum, die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, neu zu denken. Diese Umdeutungen ermöglichen es uns, uns von alten, festgefahrenen Denkmustern zu befreien und neue Perspektiven zu entwickeln.
Wenn du dich fragst, welche Geschichte du über dich erzählst und wie du sie vielleicht verändern könntest, dann melde dich doch einfach bei mir. Lass uns gemeinsam schauen, welche Narrativen du für dich selbst entwickeln kannst, um mehr Freiraum und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen.